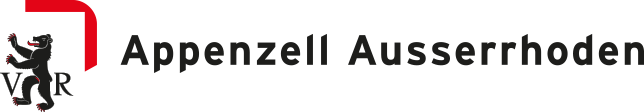Inhalt
Deponieplanung Kanton Appenzell Ausserrhoden

Die Abfallverordnung (VVEA) des Bundes verpflichtet die Kantone, eine Abfallplanung zu erstellen, die u.a. den Bedarf an Deponievolumen und die geeigneten Standorte für Deponien ausweist. In Appenzell Ausserrhoden ist für die Deponieplanung das Amt für Umwelt zuständig. Gesucht wurden ausschliesslich Standorte für die Deponierung von unverschmutztem Aushub (Deponie Typ A) sowie von mineralischen Baustoffen wie Beton, Mauerwerk und Ziegel (Deponie Typ B).
Weitere Informationen
Im Appenzellerland gibt es derzeit nur noch wenige Deponien, die mittelfristig Aufnahmekapazitäten für Aushub und gesteinsähnliche Rückbaumaterialien haben. Mit Inkrafttreten der neuen Abfallverordnung des Bundes aus dem Jahr 2016 müssen die Kantone zudem ihre Deponieplanung alle fünf Jahre überprüfen: Das Amt für Umwelt hat den Deponiebedarf im Kanton ermittelt und die bestgeeigneten Standorte für einen Planungshorizont von 20 Jahren bezeichnet. Die Resultate liegen in der kantonalen Deponieplanung vor. Diese setzt sich zusammen aus dem überarbeiteten Deponiekonzept und den evaluierten, möglichen Standorten. Das Konzept stellt überdies einen kurzen Leitfaden für alle Beteiligten dar, in dem die wichtigsten Punkte von der Planung über die Realisierung bis zur Nachsorgephase einer Deponie erläutert werden. Mit der revidierten Gesetzgebung wird die Qualität der Rekultivierung massgeblich verbessert resp. die Nachsorge intensiviert.
Deponien müssen heute umweltverträglich realisiert und betrieben werden. Natürliche Ressourcen wie Trinkwasser, Wald, Fruchtfolgeflächen sowie Natur und Landschaft werden dabei geschont.
Planung, Errichtung und Betrieb einer Deponie
Für die Errichtung von Deponien für sauberen Aushub und mineralische Bauabfälle (Typ A und B) ist unter anderem eine abfallrechtliche Genehmigung erforderlich. Die Phasen einer Deponie, die Errichtung, der Betrieb sowie die Nachsorge sind in der Abfallverordnung (VVEA, SR 814.600) geregelt.
Der vorliegende Leitfaden gibt einen Überblick über die Verfahrensschritte, die notwendig sind, um eine Deponie im Kanton Appenzell Ausserrhoden zu planen, zu errichten und zu betreiben.
Dokumentation
Vom Regierungsrat am 30. März 2021 erlassen:
»» Link zur Rubrik Abfallplanung
Weitere Dokumente/Informationen:
- Deponiestandorte Übersichtsplan, Februar 2021