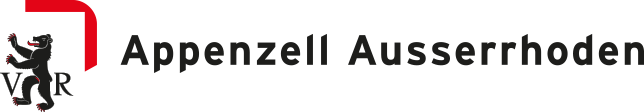Bis ins Jahr 2017 war über das Vorkommen von Steinkrebsen im Appenzellerland wenig bekannt. Eine erste Kartierung brachte überraschend mehrere Bestände ans Licht. Das Folgeprojekt, das von 2020 bis 2024 lief, baute darauf auf und verfolgte zwei Hauptziele: die gezielte Wiederansiedlung von Steinkrebsen und das Monitoring bestehender und potenzieller Vorkommen.
Zwei Wiederansiedlungen – erste Erfolge
Zwei Gewässer wurden nach eingehender Potenzialanalyse für eine Wiederansiedlung ausgewählt: der Rödelbach im Einzugsgebiet der Sitter und der Wiesenbach im Einzugsgebiet der Glatt. Im Rödelbach wurden über mehrere Jahre Jungkrebse aus der regionalen Aufzuchtstation (Flusskrebs-Station Mehlersweid) angesiedelt. Im Jahr 2024 konnte dort erstmals ein geschlechtsreifes Männchen nachgewiesen werden. Dies ist ein erster Meilenstein zur Etablierung einer neuen, sich selbst erhaltenden Population.
Im Wiesenbach wurden adulte Tiere aus einer benachbarten Population im Kanton St. Gallen umgesiedelt. Bereits 2023 konnten zahlreiche adulte Steinkrebse nachgewiesen werden, und 2024 deuten erste Funde von Jungtieren auf eine natürliche Fortpflanzung hin. Im Rahmen einer Erfolgskontrolle kann die künftige Entwicklung der Population dokumentiert werden.
Monitoring bringt überraschende Neuentdeckungen
Neben der Wiederansiedlung wurde auch die Beobachtung bestehender Populationen intensiviert. Besonders erfreulich ist der Nachweis einer bisher unbekannten Steinkrebspopulation im Gmeinwiesbächli bei Stein (AR). Diese liegt im Einzugsgebiet der Sitter, wo bislang nur wenige Bestände bekannt waren. Die Entdeckung bekräftigt das Potenzial für weitere Nachweise und unterstreicht die Bedeutung kontinuierlicher Schutzmassnahmen.
Ausblick: Schutz, Sensibilisierung und Forschung
Das Projekt leistete nicht nur einen Beitrag zur Sicherung einzelner Bestände, sondern setzte auch wichtige Impulse für den Gewässerschutz und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Die Erkenntnisse bilden eine wertvolle Grundlage für künftige Schutzprogramme. Dazu zählen:
- die langfristige Sicherung geeigneter Lebensräume,
- regelmässige Erfolgskontrollen und Bestandeserhebungen,
- sowie Aufklärung über Gefährdungsursachen wie Gewässerverschmutzung oder invasive Arten.
Mit einem fünfjährigen Folgeprojekt "Flusskrebse Appenzellerland" führen die Appenzeller Kantone nun bis 2029 ihr Engagement für den Schutz der Krebse weiter.
Beobachtungen und Hinweise gesucht
Die Region beherbergt deutlich mehr Steinkrebsvorkommen als ursprünglich angenommen. Dennoch bestehen weiterhin Wissenslücken. Hinweise aus der Bevölkerung – etwa zu aktuellen Sichtungen oder zu früheren Vorkommen – sind deshalb von grossem Wert.
Eigene Beobachtungen, Anekdoten oder alte Geschichten rund um einheimische Flusskrebse können online gemeldet werden unter: https://www.flusskrebs-station.ch/meldung.
Der ausführliche Bericht ist online verfügbar: https://ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/amt-fuer-umwelt/fischerei/fischereiverwaltung-und-fischereiaufsicht/