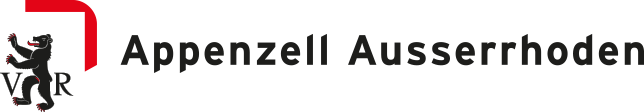Inhalt
Windenergie im Faktencheck

Rund um das Thema Windenergie gibt es viele vorgefasste Meinungen. So seien, um nur einige zu nennen, die Windstärken in der Schweiz zu schwach und Windräder gesundheitsschädigend und nicht recyclebar. Ein Faktencheck soll den hartnäckigsten Vorurteilen entgegenwirken.
Reichen die Windgeschwindigkeiten in der Schweiz aus?
Als wichtigstes Kriterium für die Eignung der Windenergienutzung ist eine mittlere Windgeschwindigkeit von mind. 4.5 m/s bzw. eine mittlere Windleistung pro Rotorfläche von mind. 100 W/m2 erforderlich. Mit grossen Rotoren lässt sich auch mit vergleichsweise leichten Brisen Strom erzeugen, weshalb Grosswindkraftanlagen gegenüber der Kleinwindkraft zu favorisieren sind. Die Nabenhöhe einer modernen Windenergieanlage liegt zwischen 90 und 140 Metern und der Durchmesser des Rotors beträgt 70 bis 140 Meter. Konstante Stromflüsse sind betriebswirtschaftlich wertvoller als grosse Erzeugungsspitzen.
Gemäss Windleistungskataster NTB Buchs sind über die Hälfte des Ausserrhoder Kantonsgebietes für die Windenergienutzung in Bezug auf die Windverhältnisse geeignet und es kann teilweise sogar von mittleren Windleistungen von über 400 W/m2 Rotorfläche ausgegangen werden. Selbstverständlich wird kein Investor in einen Windpark investieren, wenn keine verlässlichen Messresultate von mindestens einem Jahr bzgl. den effektiven Windleistungen an den vorgesehenen Standorten vorliegen.
Sind Windenergieanlagen effizient?
Auf der Fläche eines einzigen Einfamilienhauses lässt sich mit einer modernen Windturbine die Strommenge für bis 2'000 Einfamilienhäuser gewinnen. Würde die gleiche Menge an Strom mit Photovoltaik erzeugt, wäre eine Modulfläche von 30'000 m2 erforderlich (≙ 4 Fussballfelder) und um dieselbe Menge einer einzigen Windturbine an Winterstrom zu produzieren, braucht es sogar 80'000 m2 Modulfäche (≙ 11 Fussballfelder).
Die Wirtschaftlichkeit von Stromerzeugungsanlagen wird definiert durch die Gesamtkosten (Investitions-, Betriebs-, Unterhalts- und Entsorgungskosten) und dem Ertrag in Abhängigkeit der Leistung und der Auslastung (Betriebsstunden).
Photovoltaikanlagen (PVA) und Windenergieanlagen an Land (Onshore-WEA) haben trotz geringer Volllaststunden (1'000 Stunden pro Jahr bei PVA und knapp 2'000 Stunden pro Jahr bei Onshore-WEA) die tiefsten Stromgestehungskosten, da sie vor allem tiefe Investitionskosten pro Kilowatt installierter Leistung aufweisen. Dahingegen weisen Kernkraftwerke trotz optimaler Auslastung (rund 8'000 Volllaststunden) verhältnismässig hohe Stromgestehungskosten aus, was u.a. mit den relativ hohen Betriebskosten, Entsorgungskosten und Folgekosten zusammenhängt (Quelle: Internationale Energieagentur IEA; World Energy Outlook 2022).
Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Windenergieanlagen?
Zur Beurteilung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses sind die Gesamtkosten aus Erstellung und Betrieb (inkl. Unterhalt und Entsorgung) durch den Stromertrag – über den ganzen Lebenszyklus der Anlage – zu dividieren.
Bei der Metrik «VALCOE» (Value Adjusted Levelized Cost of Energy) werden nebst den reinen Stromgestehungskosten auch der Nutzen, den eine Technologie zur Netzstabilität leistet, berücksichtigt. Als attraktiv gilt dabei die zeitliche Flexibilität bei der Stromerzeugung oder die maximal verfügbare Kapazität bei der Spitzenstromnachfrage im Laufe eines Tages.
Auch mit Berücksichtigung dieser Wertbereinigung sind die Windkraft (auf dem Land) und die Solarkraft die günstigsten Stromerzeugungsmethoden (Quelle: Brent Wanner, Leiter Energiesektor Internationale Energieagentur IEA). Die Gesamtkosten eines diversifizierten Stromproduktionsmixes sind allerdings günstiger als energiepolitische Monokulturen, da sich die Risiken und Nachteile der verschiedenen Technologien ausgleichen.
Sind Windenergieanlagen laut?
Windenergieanlagen dürfen von Gesetzes wegen nicht laut sein, da sie die Anforderungen der Lärmschutzverordnung erfüllen müssen. Im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung werden die Betriebsgeräusche von geplanten Anlagen abgeklärt. Zudem sind die Anlagen in den letzten Jahren durch Flügel mit Kämmen und gebogenen Blattenden deutlich leiser geworden. Das Rauschen von modernen Windenergieanlagen ist nicht lauter als ein Gespräch.
Machen Windenergieanlagen infolge Infraschall krank?
Infraschall ist Schall unterhalb des Hörbereichs, also mit Frequenzen von weniger als 20 Hz.
Infraschall ist ein fester Bestandteil unserer Lebenswelt und kann sowohl aus natürlichen als auch aus technischen Quellen hervorgehen. Natürliche Quellen sind z.B. Wind, Gewitter, Wasserfälle, Vulkane, Meteoriten usw. Technischen Ursprungs ist Infraschall von bspw. Kraftfahrzeugen, Klima- und Lüftungsanlagen sowie Kühlschränken. Eine Studie im Auftrag des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg aus dem Jahr 2024 zeigt, dass Infraschall von Windkraftanlagen weit unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsgrenze liegt und keine nachweisbaren gesundheitlichen Auswirkungen hat.
Blinken die Signalleuchten von Windenergieanlagen in der Nacht ununterbrochen?
Windenergieanlagen können heute mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausgerüstet werden, deren Signalleuchten nur blinken, wenn sich tatsächlich ein Flugobjekt nähert. Die Detektionstechnologie ortet die Positionen von Flugobjekten und aktiviert die Leuchtfeuer der Windenergieanlagen nur dann, wenn sich Objekte im kritischen Luftraum bewegen. Dazu empfangen spezielle Sensoren die Transpondersignale aus Luftfahrzeugen. Das sind die Signale, die auch Fluglotsen die Höhe und Position von Flugzeugen auf ihrem Radarschirm anzeigen. In Deutschland und Österreich wird die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung bereits erfolgreich eingesetzt.
Verschatten Windenergieanlagen Wohngebäude?
Schattenwurf von Windenergieanlagen entsteht während direktem Sonnenschein durch den Turm und die Rotorblätter. Je nach Wetter und Sonnenstand können die Rotorblätter bewegte Schatten werfen. Derzeit gibt es in der Schweiz keine Grenz- oder Richtwerte, ab wann die Immissionen von Windenergieanlagen an einem bestimmten Ort als schädlich oder lästig zu beurteilen sind. Es werden jedoch entsprechende an die deutschen Werte angelehnte Richtlinien angewandt: Der bewegte Schatten darf maximal 30 Minuten am Tag auf ein bewohntes Gebäude fallen – und zwar nur bis zu 30 Stunden im Jahr (astronomisch maximal möglicher Schattenwurf, Worst Case) resp. 8 Stunden im Jahr (meteorologisch wahrscheinlicher Schattenwurf, reale Schattendauer).
Verursachen sich drehende Rotorblätter ein «Flackern» (Stroboskop-Effekt)?
Der Stroboskop- oder Diskoeffekt entstand früher durch Lichtreflexionen an den Rotorblättern. Dieser Effekt tritt bei modernen Windenergieanlagen nicht mehr auf, da diese mit matten, nicht reflektierenden Farben gestrichen werden.
Gibt es für Windenergieanlagen einen Mindestabstand zu Wohngebäuden?
In der Schweiz bemisst sich der Abstand von Windenergieanlagen zu Wohngebäuden und Siedlungen insbesondere über die Anforderungen der Lärmschutzverordnung und weiteren strengen gesetzlichen Vorgaben. Da sich die Verbreitung der Geräusche sowie des Schattens je nach Standort unterscheidet (bspw. in Abhängigkeit der Topographie), lassen sich Abstände generell nicht pauschalisieren bzw. Mindestabstände wären alles andere als zielführend. Nur die gesetzlich verankerten Vorschriften stellen wirklich sicher, dass für jedes Projekt ein ausreichender Abstand gewährleistet wird.
Zahlreiche Studien zeigen zudem: Der Wohnabstand zu Windenergieanlagen hat keinen Einfluss auf die Akzeptanz.
Ist der Materialbedarf für Rotorblätter ein Treiber für illegale Holzrodungen in Südamerika?
Für die Rotorblätter von Windenergieanlagen wird teilweise Balsaholz verwendet. Der Balsabaum ist eine unkomplizierte, schnellwachsende und nicht bedrohte Pflanzenart, die in Südamerika beheimatet ist. Infolge stark gestiegener Preise mehrten sich in den letzten Monaten Berichte über illegale Rodungen und verstärkten Schwarzmarkthandel in Zusammenhang mit Balsaholz. Die europäische Windbranche bezieht allerdings schon seit Jahren ausschliesslich FSC-zertifiziertes Balsaholz, wobei eine nachhaltige Waldbewirtschaftung gewährleistet und illegale Rodungen in Zusammenhang mit der Produktion von Windenergieanlagen ausgeschlossen werden können. Viele Hersteller haben zudem bereits vor mehreren Jahren damit begonnen, Balsaholz durch speziellen PET- bzw. PVC-Schaum zu ersetzen. Lediglich bei rund 30 % der heute produzierten Rotorblätter kommt Balsaholz überhaupt noch zum Einsatz.
Gelangt durch Windenergieanlagen Mikroplastik in die Umwelt?
Durch witterungsbedingte Erosionen an den beschichteten Rotorblättern wird Mikroplastik freigesetzt. Es kann davon ausgegangen werden, dass aus den in der Schweiz installierten 41 Grosswindanlagen ein Materialabtrag von insgesamt maximal 2 Tonnen pro Jahr resultiert. Neueste Studien gehen sogar von nur wenigen hundert Gramm pro Anlage und Jahr aus. Demgegenüber stehen die Abriebwerte von Schuhsohlen mit über 900 Tonnen und von Reifen (Pneus) mit über 7'000 Tonnen pro Jahr.
Was geschieht nach der Nutzungsdauer mit den Windenergieanlagen?
Die Hauptbestandteile von Windanlagen sind Beton (Fundament), Stahl (Fundament, Turm und Getriebe) sowie ein Verbund aus Kunststoff mit Glas- oder Karbonfasern in den Rotorblättern. Bereits heute sind bis zu 90 % der Baumaterialien einer Windenergieanlage leicht wiederverwendbar.
Windenergieanlagen sind aktuell für eine Lebensdauer von 20-30 Jahre ausgelegt. Am Ende der Lebensdauer kann der Beton zerkleinert und als Kiesersatz beim Strassenbau oder für neuen Beton genutzt werden (Recyclingbeton). Der wertvolle Stahl wird zu neuem Stahl recycelt. Auch andere wertvolle Metalle wie Kupfer und Aluminium werden wiederverwertet. Da Rotorblätter leicht, flexibel und widerstandsfähig sein müssen, werden Verbundmaterialien wie Glasfaser- oder Kohlefaserverbundstoffe eingesetzt. Diese langlebigen Stoffe lassen sich nur schwer in ihre Einzelkomponenten zerlegen. Allerdings können diese weiter zerkleinert werden und dienen dann als Beimischmaterial zum Beispiel in der Zementindustrie, bei Lärmschutzwänden oder als Zusatzstoff für verstärkte Kunststoffe.
Sind Schmiermittel für Windenergieanlage problematisch für die Umwelt?
Wie bei anderen Maschinen und Geräten in Industrie, Gewerbe und Privatbereich (bspw. bei Fahrrädern) werden auch bei Windenergieanlagen Schmiermittel eingesetzt. In der Gesamtheit macht der Anteil an Schmiermitteln bei Windenergieanlagen nur einen unbedeutenden Bruchteil des schweizweiten Schmiermittelbedarfs aus. Zur Verfügung stehen Hochleistungs-Bioschmierstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe, wodurch ein zusätzlicher Beitrag zur Umweltverträglichkeit geleistet wird. Die biologische Abbaubarkeit von Schmierstoffen reduziert zudem die Aufwendungen im Leckagefall.
Windkraftanlagen dürfen gemäss den schweizerischen Umweltvorschriften keine schädlichen Stoffe in die Umwelt abgeben. Folglich darf das Schmieröl, das für den Unterhalt der beweglichen Teile der Anlage verwendet wird, nicht in den Boden gelangen und schon gar nicht ins Grundwasser (Windenergieanlagen sind in den Grundwasserschutzzonen S1 und S2 nicht erlaubt).
Ist der Einsatz von SF6 bei Windenergieanlagen problematisch?
In elektrischen Schaltungen für Hoch- und Mittelspannung wird seit den 1960er Jahren ein extrem gut isolierendes, aber leider auch extrem klimawirksames Gas namens Schwefelhexafluorid (SF6) genutzt. Windenergieanlagen sind ein Einsatzgebiet für solche Schaltungen, das Gas findet sich aber auch in jedem anderen Kraftwerk, in Umspannwerken, in Trafos, Hochspannungsrohrleitern, Teilchenbeschleunigern, Röntgenanlagen und Radarsystemen. Solange sich das Gas in den gekapselten Schaltungen befindet, wirkt es sich nicht negativ auf das Klima aus. Würde das gesamte SF6 einer WEA durch einen – sehr unwahrscheinlichen – Defekt freigesetzt, entspräche das etwa einer Belastung von 75 t CO2-Äquivalent. Demgegenüber spart eine grosse Windenergieanlage im Laufe ihrer Betriebszeit weit über 100'000 t CO2 ein.
Eine neue Alternative zu SF6 in Hochspannungsschaltanlagen ist das Gasgemisch g3. Dieses hat ein um 98 % geringeres Klimaerwärmungspotential als SF6.
Beeinflussen Windenergieanlagen infolge Luftverwirbelungen das Klima?
Durch die Drehung der Rotorblätter von Windenergieanlagen werden Luftschichten durchmischt. Nachts und morgens, wenn die Sonne nicht scheint, wirbeln Windenergieanlagen die kalte Luft vom Boden nach oben und die warme zum Boden hin. Die Folge können wärmere Temperaturen am Boden in unmittelbarer Nähe der Anlagen sein. Aus bestimmten Wetterlagen können aber auch kalte Luft in Bodennähe gewirbelt werden und damit zu sinkenden Temperaturen führen. Differenzierte Studien zeigten sogar, dass der Boden an spezifischen Standorten durch die Umverteilung der Luftschichten absolut feuchter wird. Die Folgen daraus sind allerdings weder Dürren noch eine Erwärmung der Atmosphäre. Windenergieanlagen können höchstens einen Einfluss auf das Mikroklima am Standort haben.
Wie ist die Ökobilanz von Windenergieanlagen?
Die Nutzung der Windenergie ist neben der Wasserkraft die ökologischste Art der Stromgewinnung. Auf geringster Fläche wird mit Windenergieanlagen während 20 bis 30 Jahren eine sehr grosse Strommenge produziert und dies vorwiegend im Winterhalbjahr – also dann, wenn der Strombedarf am grössten ist. Auf diese Weise werden Stromimporte vermieden, welche teilweise aus fossilen Kraftwerken stammen und deshalb stark CO2-belastet sind. Der Schweizer Verbraucherstrommix (Strom aus der Steckdose) wies im Jahr 2022 – mit Berücksichtigung der Stromimporte – eine CO2-Bilanz von 112 Gramm pro Kilowattstunde auf.
Eine Windenergieanlage spart während ihrer Laufzeit rund das 40-fache an CO2-Emissionen ein, welche für ihre Herstellung, Montage, Nutzung und Entsorgung benötigt werden. Die sogenannte graue Energie (Energiebedarf für Herstellung, Montage, Nutzung und Entsorgung) ist i.d.R. nach weniger als einem Jahr Betrieb kompensiert. Keine andere Stromerzeugungsart weist eine derart kurze energetische Amortisationszeit auf.
Wird die Landschaft durch Windenergieanlagen verschandelt?
Inwiefern Windenergieanlagen die Landschaft negativ beinträchtigen, liegt einerseits im Auge des Betrachters und ist andererseits Gewohnheitssache. Der Mensch hat die natürlichen Gegebenheiten schon immer für seine Zwecke genutzt. So sind Stromleitungen, Seilbahnen, Eisenbahnschienen und Autobahnen heute zweifellos Teil unseres Landschaftsbildes. Um den landschaftlichen Eingriff so gering wie möglich zu halten, werden im Idealfall Windparks mit mehreren grossen Anlagen gebaut.
Die grössten Schweizer Windenergieanlagen haben eine Nabenhöhe von rund 130 m und Rotordurchmesser von fast 120 m. Die Gesamthöhe beträgt somit rund 190 m.
Wird für Windenergieanlagen Wald gerodet?
Eine Auswertung des Bundesamts für Umwelt (BAFU) hat ergeben, dass für eine Windenergieanlage im Wald mit einer Gesamtrodungsfläche (definitive plus temporäre Rodung) von rund 0,5 bis 1 Hektar zu rechnen ist. Das tatsächliche Ausmass der Rodungen hängt davon ab, welcher Anteil der Anlagen im Wald zu liegen kommt. Auch wenn Rodungen gemäss Waldgesetz grundsätzlich verboten sind, können diese beim Vorliegen von wichtigen Gründen bewilligt werden. Beispiele dafür sind der Bau einer Autobahn durch den Wald oder aber die Erstellung eines Windparks von nationalem Interesse.
Bei der Festlegung der Gebiete für Solar- und Windkraftanlagen müssen die Kantone die Interessen des Landschaft- und Biotopschutzes und der Walderhaltung sowie die Interessen der Landwirtschaft, insbesondere des Kulturlandschutzes und des Schutzes der Fruchtfolgeflächen, berücksichtigen (Art. 10 Abs. 1ter EnG). Falls eine Rodung bewilligt wird, ist ein Realersatz in derselben Gegend zu leisten. Ein Blick über die Grenze nach Deutschland zeigt: Tiere und Fauna gewöhnen sich gut an Windenergieanlagen im Wald. Die Biodiversität kann sogar aufgewertet werden.
Leidet der Tourismus unter Windenergieanlagen?
Es ist kein belegbares Beispiel bekannt, bei dem durch Windenergieanlagen negative Auswirkungen auf Tourismusaktivitäten eingetreten sind. Durch die Entstehung von Windparks können sogar neue zusätzliche Tourismusaktivitäten aufgebaut werden und die Destination kann aufzeigen, dass sie Verantwortung gegenüber der Umwelt übernimmt.
Sind Windenergieanlagen gefährlich für Tiere?
Durch eine umsichtige Auswahl der Standorte für die Nutzung der Windenergie werden Kollisionen oder die Beeinträchtigung von Fledermaus- und Vogellebensräumen oder Zugrouten vermieden oder zumindest minimiert. Viele Naturschützer begrüssen den Ausbau der Windkraft, da die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität viel einschneidender wären. Kollisionen zwischen Windenergieanlagen und Flugtieren können nicht ausgeschlossen werden, so wie (viel häufiger vorkommende) Kollisionen im Strassen- oder Schienenverkehr oder mit Gebäudefassaden nicht ausgeschlossen werden können.
Bezüglich Nutztieren gibt es keine Hinweise auf Störungen durch Windenergieanlagen. Weidende Kühe, Pferde und Schafe am Turmfuss von Windenergieanlagen lassen darauf schliessen, dass Nutztiere nicht gestört werden bzw. sich nach kurzer Zeit an die Anlagen gewöhnen. Nach heutigem Kenntnisstand nutzt das Wild nach einer Gewöhnungsphase die Umgebung von Windparks wieder als Lebensraum.
Sind allfällige Eisschichten an den Rotorblättern gefährlich?
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, bei Schneefall oder Eisregen können sich auf den Rotorblättern des Windrades, genauso wie auf Handymasten, Bäumen oder Stromleitungen, Eisschichten bilden. Die Eisbildung wirkt sich negativ auf den Anlagenbetrieb aus. Die Rotorblätter werden „unwucht“, wie man das von Autoreifen kennt. Ein Betrieb des Windrades in diesem Zustand würde sich negativ auf die ganze Anlage selbst auswirken, weil sie durch diesen Zustand sehr stark belastet würde. Der Gefahr eines Eisabwurfs wird durch Rotorheizungen oder Abschalteinrichtungen entgegenwirkt. So wird bei modernen Grosswindanlagen ein Eisansatz durch die Anlagensoftware erkannt und automatisch die notwendigen Massnahmen eingeleitet sowie die Anlagenbetreiber online informiert.
Haben Windenergieanlagen einen negativen Einfluss auf Immobilienpreise?
In einer Untersuchung von Wüest Partner AG wird deutlich, welche Schwierigkeiten sich bei der Beantwortung der Frage ergeben, ob Immobilien infolge Windenergieanlagen an Wert verlieren. Die Lage eines Hauses, die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, der bauliche Zustand oder störende Einflüsse in der Nähe wie Strassenlärm oder Stromleitungen: Es gibt zahlreiche Faktoren, die den Preis einer Immobilie unterschiedlich stark beeinflussen, nach oben und nach unten.
Negative Auswirkungen auf Immobilienpreise infolge von Windenergieanlagen können bisher weder festgestellt noch belegt werden.
Wie werden Windenergieanlagen finanziert?
In vielen Fällen werden Windenergieanlagen von privaten Unternehmen oder Investoren finanziert, die sie anschliessend betreiben und den erzeugten Strom verkaufen. Es können aber auch Bürgerinnen und Bürger an der Finanzierung beteiligt werden, bspw. durch Crowdfunding oder Gemeinschaftsprojekte. Für neue Windenergieanlagen und Ersatzbauten können beim Bund Investitionsbeiträge beantragt werden. Die Finanzierung der einheimischen erneuerbaren Energien erfolgt durch den Netzzuschlag. Im Unterschied zur Kernenergie sind die Kosten in der Stromrechnung transparent ausgewiesen und es findet keine Quersubventionierung statt.
Aufgrund notwendiger Investitionen in Infrastruktur und Technologie könnte die Energiewende kurzfristig höhere Strompreise bedeuten. Die Vermeidung von Folgekosten von umweltschädlichen Technologien, die niedrigeren Betriebs- und Entsorgungskosten sowie die reduzierte Abhängigkeit vom Ausland im Zusammenhang mit Energieimporten wird sich allerdings längerfristig positiv auf die Energiekosten auswirken. Der Umstieg auf eine unabhängige Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen wirkt somit den steigenden Energiepreisen entgegen.
Setzen Windenergieanlagen Gas-Backup-Kraftwerke für windstille Tage voraus?
Bei den meisten erneuerbaren Energiequellen wirkt sich die Witterung auf den Ertrag aus, woraus saisonale Schwankungen resultieren. Im Unterschied zu den Solar- und Wasserkraftwerken haben Windenergieanlagen ihre Produktionsspitze während der kalten Jahreszeit bzw. produzieren rund zwei Drittel ihres Jahresertrags im Winterhalbjahr. Grosse Windenergieanlagen sind somit die optimale Ergänzung zu den anderen erneuerbaren Quellen. Und für windstille Tage ohne Sonnenschein verfügt die Schweiz über Speicherseen mit einer gigantischen Kapazität von rund 8.9 Terawattstunden (TWh). Gemäss aktuellem Stromverbrauch reicht diese Kapazität aus, um die ganze Schweiz zwischen 7 und 8 Wochen lang mit Strom zu versorgen. Trotz zunehmendem Stromverbrauch infolge Umstieg von Öl- und Gasheizungen auf grösstenteils Wärmepumpenheizungen sowie dem Wechsel von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu Elektrofahrzeugen wird diese Speicherreserve auch in Zukunft mehr als einen Monat ausreichen. Der Bau von Windkraftanlagen unterstützt massgeblich die Versorgungssicherheit und reduziert den Bedarf von Gas-Backup-Kraftwerken.
Wird das Netz durch Windenergieanlagen überlastet?
Der Stromertrag von einzelnen Windenergieanlagen ist genauso unregelmässig wie die Stromnachfrage der einzelnen Stromkonsumierenden bzw. die Nachfrage in Abhängigkeit der Tages- und der Jahreszeit. Der Verbrauch hat schon immer stark variiert und Überschüsse (bspw. durch Kernkraftwerke in der Nacht) müssen zwischengespeichert werden. Strom aus Windenergieanlagen fällt v.a. im Winterhalbjahr an. Also dann, wenn die Nachfrage gross ist und andere Technologien wie PV-Anlagen oder Wasserkraftwerke weniger Strom liefern. Daher kann Windenergie sogar netzdienlich wirken. Grössere Differenzen zwischen Angebot und Nachfrage werden nach wie vor über die Speicherseen mit deren riesigen Kapazität geregelt werden.
Kann die Windenergie einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung leisten?
Der notwendige Umstieg von fossilen Brennstoffen auf kohlenstofffreie und erneuerbare Energiequellen (Dekarbonisierung) führt zu einer Elektrifizierung des Verkehrs- und des Gebäudesektors. Trotz Zunahme des Elektrizitätsbedarfs, wird der Endenergieverbrauch infolge Effizienzmassnahmen und Sektorenkopplungen in der Summe sinken, da Wärmepumpenheizungen und Elektroautos rund drei bis viermal effizienter sind als herkömmliche Systeme. Da bei Windenergieanlagen rund zwei Drittel der Jahresproduktion auf das Winterhalbjahr fallen, kann bereits mit wenigen Terrawattstunden ein wesentlicher Beitrag zur künftigen Versorgungssicherheit geleistet werden.