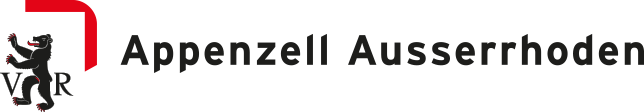Inhalt
Untersuchungen / Qualität

Mit der Überwachung der Fliessgewässerqualität wird der Zustand der Gewässer dokumentiert. Die Untersuchungen sind auch Teil der Erfolgskontrolle der Gewässerschutzmassnahmen im Einzugsgebiet. Die Überwachung erfolgt mittels periodischer Messkampagnen. Massgeblich für die Beurteilung ist das Modul-Stufen-Konzept des Bundes.
Fliessgewässer-Überwachung
Die Überwachung der Fliessgewässer erfolgt mittels unterschiedlicher, periodischer Untersuchungskampagnen. Diese werden zum Teil in Koordination mit den Nachbarkantonen durchgeführt:
- fünfjährliche Gesamtuntersuchung AR/AI: An den wichtigsten Stellen der appenzellischen Fliessgewässer werden durch Spezialisten der äussere Aspekt (Farbe, Schaum, Schlamm ua.), die Wasserchemie, die Fischnährtiere und Kieselalgen sowie die Fischpopulation untersucht.
- Vorfluteruntersuchung: In Koordination mit den ausserrhodischen Kläranlagen werden monatlich gewässerchemische Untersuchungen unter- und oberhalb der Kläranlageneinleitungen sowie an ausgewählten zusätzlichen Messstellen durchgeführt.
- Sitter und Glatt werden zusätzlich im Rahmen der kantonsübergreifenden Zusammenarbeit im Zweimonatsrhythmus chemisch sowie im Mehrjahresrhythmus gewässerbiologisch untersucht.
Zustand der Fliessgewässer
Im Vergleich zu den Erhebungen von 2019 zeigt sich im Jahr 2024 ein ähnliches Bild des Zustands der Appenzeller Fliessgewässer. Der biologische Zustand – beurteilt anhand von Kieselalgen und Makrozoobenthos – kann überwiegend als gut bis sehr gut bezeichnet werden.
Die Wasserqualität wurde in den meisten untersuchten Gewässern als „gut“ bewertet. An einzelnen Stellen konnten die gesetzlichen Anforderungen jedoch nicht vollständig erfüllt werden: dort zeigte sich lediglich eine „mässig“ gute Wasserqualität. Hauptursachen dafür waren erhöhte Nährstoffeinträge (vor allem Phosphor) sowie organische Belastungen anhand der Gesamtheit ungelöster Stoffe im Herbst nach starken Niederschlägen.
Beim äusseren Erscheinungsbild wurden Beeinträchtigungen festgestellt. Dazu zählen insbesondere Schaumbildung, Schlammablagerungen und eine teilweise verfestigte Gewässersohle (Kolmation). Diese Befunde machen deutlich, dass trotz der positiven Entwicklung weiterhin Handlungsbedarf für die ökologische Aufwertung und Pflege der Gewässer besteht.
Sitterkommission
Die Sitterkommission, eine 1986 ins Leben gerufene Arbeitsgruppe von Fachpersonen der beteiligten Kantone, der Stadt St. Gallen und der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke koordiniert die Überwachung und beurteilt die Qualität der Sitter. Sie informiert mitbefasste Behörden und die Öffentlichkeit, schlägt zuhanden der zuständigen Amtsstellen Massnahmen bezüglich festgestellter Defizite vor und stellt die Erfolgskontrolle sicher.
Im Jahr 2000 hat die Kommission den ersten «Bericht zur Sitter» veröffentlicht, der alle wesentlichen Informationen des Zustands und der Nutzungen an und in der Sitter dokumentiert und Verbesserungsmassnahmen benannt.
Mit der Sitterkommission zeigen die beteiligten Institutionen und Ämter auch exemplarisch auf, wie der Schutz und die Nutzung eines kantonsüberschreitenden Gewässers als gemeinsame Aufgabe effizient und unkompliziert geplant und erfolgreich umgesetzt werden.
Weitere Informationen zur Sitter und Sitterkommission:
»» www.diesitter.ch
Glattkommission
Die Glattkommission wurde 1984 als Fach- und Koordinationsgremium von den Regierungsräten der beiden beteiligten Kantone eingesetzt. Sie umfasst Vertreter der beiden kantonalen Umweltschutzämter, aller Glattgemeinden, Interessen- resp. Branchenvertreter (Industrie, Landwirtschaft) sowie Fachspezialisten. Die Glattkommission hat - obschon im offiziellen Auftrag der beiden Kantone arbeitend - keine Vollzugskompetenz; es handelt sich um ein beratendes Gremium. Die Arbeit konzentriert sich auf die Problemdefinition und die Erarbeitung von Lösungen im Konsens. Massnahmen und Lösungsvorschläge werden als Empfehlungen an die Ansprechpartner (z.B. Industrie) resp. Vollzugsbehörden formuliert.
Basis der Arbeiten der Glattkommission ist die kontinuierliche Abwasser- und Gewässeruntersuchung. Sie ermöglicht die Quantifizierung einzelner Teilprobleme, die Prioritätensetzung und eine Gesamterfolgskontrolle. Die eigentliche Projektarbeit der Glattkommission erfolgt in den thematischen Arbeitsgruppen.
Die Finanzierung der Arbeiten der Glattkommission resp. der Arbeitsgruppen erfolgt projektorientiert. Ein Spezialfall ist die Öffentlichkeitsarbeit, welche ausschliesslich durch die Gemeinden finanziert wird.
»» Link zu den Zeitschriften über die Glatt aus den Jahren 1993 bis 2017 (Suchfunktion Glatt eingeben)
Vorfluteruntersuchung Appenzell Ausserrhoden
| Vorfluter Bericht Messdaten 2017 bis 2020 |
| Vorfluter-Bericht Messdaten 2013 bis 2016 |
| Vorfluter-Bericht Messdaten 2009 bis 2012 |
| Vorfluter-Bericht Messdaten 2007 bis 2008 |
| Vorfluter-Bericht Messdaten 2005 bis 2006 |
| Vorfluter-Bericht Messdaten 2003 bis 2004 |
Fliessgewässeruntersuchung Appenzell Ausserrhoden
Fliessgewässeruntersuchung grenzüberschreitend
| Fischereibiologische Detailstudie Sitter 2021 |
| Fliessgewässerüberwachung OGT 2022 (Urnäsch/Sitter - Necker/Thur); AWE St. Gallen |
| Biologische Untersuchungen Chellenbach, Dorfbach Gossau, Glatt (Bericht der Untersuchungen 2017) |
| Glattbericht 2022 (Untersuchung Januar 2018 bis Dezember 2022) |
| Glattbericht 2018 (Untersuchung Januar 2014 bis Dezember 2017) |
| Glattbericht 2014 (Untersuchung Oktober 2011 bis Dezember 2013) |
| Glattbericht 2007 (Untersuchung Januar 2005 bis Dezember 2006) |
| Organische Spurenstoffe in Flüssen und Bächen der Ostschweiz (Bericht der Untersuchung 2005 bis 2007) |
| Sitterbericht 2005 bis 2008: Chemische Untersuchung der Sitter |
| Bericht zur Sitter 2000: ein Fluss, vier Kantone, ein Bericht |
| Routineüberwachung Fliessgewässer 2016 (AFU SG): Einzugsgebiet Sitter und Urnäsch, Beurteilung des biologischen Gewässerzustandes |
| Bericht zum Geschiebehaushalt der Thur 2007 |
| Link externe Seite AFU SG "Kurzberichte zu einzelnen Fliessgewässern" (Sitter und Glatt) |